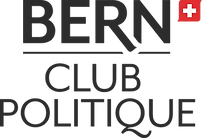Digitalisierung der Schweizer Gesellschaft
Referat Dirk Lindenmann
Schwerpunkte und Perspektiven für die Digitale Verwaltung
Das Bundesamt für Informatik und Telekommunikation (BIT) erbringt Dienstleistungen für alle Bundesämter, für Meteo-Schweiz und auch für die Kantone. Es stellt Informatiklösungen her, entwickelt Software, baut sie auf und führt sie ein bis sie operativ ist. Das BIT stellt Arbeitsplatzsysteme für die 38’000 Arbeitsplätze in der Bundesverwaltung bereit und betreibt sie. Es gehört zum Auftrag des BIT, Dienstleistungen kostengünstig zu erbringen und eine schwarze Null zu schreiben. Macht es Gewinne, geht das Geld ans Parlament zurück.
Das BIT ist mit seinen 1200 Mitarbeitern auch zuständig für die Internet-Sicherheit, intern und extern. Es betreibt 600 Fachanwendungen und Kundenprojekte. Geprägt ist die Arbeit im BIT durch fundamentalen Wandel. Die Welt verändert sich rasch, das Wissen expandiert. Es ist eine Herkulesaufgabe, sich diesem Wandel zu stellen. Der Druck steigt auch durch die Verbindungen mit dem Ausland. Informationen über Bankdaten, Steuerdaten werden ausgetauscht. Ein weiteres wichtiges Wort heisst Transparenz. Die Bevölkerung will wissen, was mit den Daten passiert, siehe Covid-Zertifikat und Covid-App. Was heisst eigentlich Digitalisierung? Richtig verstanden wird der Begriff, wenn darunter komplett automatisierte Geschäftsprozesse gemeint sind. Ein Beispiel für gelungene Digitalisierung ist der Rückerstattungsprozess für die Mehrwertsteuer für Unternehmungen. Früher wurde das von Hand gemacht, am Stichtag 30.6. standen die Unternehmungen bei der Steuerverwaltung Schlange. Heute gibt es eine Webseite, und innerhalb von 5 Sekunden ist die Sache erledigt.
Bei der Digitalisierung sind Bürgerinnen und Bürger «unwilling customers», das heisst, sie wollen mit der Digitalisierung möglichst wenig zu tun haben. Sie wollen auch nicht wissen, wer zuständig ist, sie wollen einfach, dass es funktioniert. Das Beispiel Covid: Da stellte sich die Frage, wie man die Leute dazu bringt, zuhause zu arbeiten. Jetzt geht es darum, sie wieder ins Büro zu bringen. Im BIT gibt es keine Büros mehr, jeder arbeitet dort, wo Platz ist. Wir müssen die Arbeitsplätze zu den Angestellten bringen. Wenn es um digitale Prozesse geht, kann man die BIT-Angestellten schulen, Bürgerinnen und Bürger aber nicht, sie müssen die Software sofort verstehen.
Das BIT ist dabei, die Verwaltung der Zukunft aufzubauen. Das heisst: Es gibt einen 24-Stunden-Service, der Bürger will auch am Sonntag Fragen stellen können. IT-Mitarbeiter müssen flexibel werden, wir müssen uns anders aufstellen. Willkommen ist auch Zusammenarbeit mit anderen Ländern, das passiert heute schon mit Österreich.
«Digital first» heisst: alle Prozesse sofort umsetzen. In Dänemark zum Beispiel ist alles digital. Der Bürger muss aber eine «option-out»-Möglichkeit haben, so wie z.B. bei der Mehrwertsteuer. Da läuft heute aber fast alles online. Die E-ID, die elektronische Identität, ist für die öffentliche Verwaltung ein Schlüssel. Da ist es wichtig, dass die Fachämter mit dem BIT zusammenarbeiten. Bei der E-ID gehen wir einen neuen Weg. Früher wurde ein Gesetz geschrieben und dann umgesetzt. Jetzt schauen wir, wie etwas umgesetzt werden kann und erst, wenn es funktioniert, wird ein Gesetz geschaffen, das die Technik nicht einschränkt. Die E-ID beginnen wir mit Prototypen, zum Beispiel einem elektronischen Führerausweis für Neulenker. Die Bevölkerung muss erkennen, was die Vorteile einer E-ID sind, sie muss wissen, dass es nicht nur Risiken gibt. Wir müssen Datensparsamkeit gewährleisten, oft braucht ein Anbieter von Dienstleistungen z.B. nicht zu wissen, wie alt jemand ist.
Was die Cloud anbelangt, ist eine völlige Unabhängigkeit illusorisch, das BIT ist gefordert, mit Cloud-Anbietern zusammenzuarbeiten. Aber wir müssen es schaffen, die Daten unter Kontrolle zu halten. Punkto Cybersicherheit arbeitet das BIT zusammen mit dem Bundesamt für Cybersicherheit.
Referat Sascha Zahnd
Präsident von digitalswitzerland bin ich auf Initiative von Marc Walder geworden, der mich nach meinem Engagement bei Tesla geholt hat. Walders Ziel mit digitalswitzerland ist es, auch in 20 Jahren noch eine im Digitalbereich führende Nation zu sein. Bei der Digitalisierung sind Wirtschaft und Gesellschaft gefordert. Digitalswitzerland, finanziert von der Wirtschaft, hat viele sehr aktive Mitglieder. Wir bieten uns KMUs an, machen IT-Schulungen, sind in Schulen aktiv, v.a. an Privatschulen, die bisher offener waren als öffentliche Schulen.
Die E-ID ist auch für uns zentral. Digitalswitzerland soll eine Plattform werden, nicht die 10. Organisation, die irgend etwas macht. Wir wollen Leute zusammenbringen, vermitteln. Z.B. arbeiten wir mit dem Berner KMU-Verband zusammen und mit dem Kanton Luzern. In Luzern geht es um die Digitalisierung von Bereichen, die noch nicht digitalisiert sind. Auch Hochschulen machen mit, sogar Einzelpersonen. Digitalswitzerland ist also eine ziemlich chaotische Sache, wir wollen Strukturen brechen, nicht spezifische Interessen vertreten, sondern im Interesse der Gesellschaft funktionieren. Auch ökologische Themen sind uns wichtig, und wir sehen nicht nur die Chancen, sondern auch die Gefahren der Digitalisierung. Wir haben auch viele Kontakte mit Bundesbern, im Prinzip helfen wir dort, wo wir gebraucht werden, wo wir gefragt werden.
Diskussion
Dominique Reber: Welche Rolle spielt die Technologie bei der Digitalisierung überhaupt noch`
Dirk Lindenmann: Technologie ist nach wie vor fundamental. Gefragt sind Leute, welche die Technologie verstehen, aber vor allem auch Prozesse neu denken können.
Sascha Zahnd: Man muss die Leute dort abholen, wo sie stehen. Ich selber hatte nie das Bedürfnis, Programmieren zu lernen, ich habe es einmal versucht, aber es gibt Leute, die das besser können.
Dominique Reber: Eine persönliche Erfahrung: Ich wollte am Zoll Olivenöl verzollen, musste aber erfahren, dass der Dienst gerade nicht funktioniere. Gibt es nicht Streit in der Bundesverwaltung, wenn sie auch am Wochenende operativ sein soll?
Dirk Lindenmann: Tatsächlich reagieren Personalverbände beim Thema Schichtarbeit mit Schnappatmung. Man muss erklären, wieso man etwas verlangt, welche Dienstleistungen erwartet werden. Wichtig ist auch, dass man auch über das spricht, was gut läuft, nicht nur über das Umgekehrte. Die Angestellten müssen sich an neue Arbeitswelten gewöhnen, sie und die Kunden müssen merken, wie man mit neuen Techniken umgeht.
Dominique Reber: Sind Gespräche mit Gewerkschaften, mit Personalverbänden schon am Laufen?
Sascha Zahnd: Wir haben limitierte Ressourcen. Die Bundesverwaltung erlebe ich nicht überall, aber meistens als offen, dies im Gegensatz zu den Verbänden. Viele Verbände werden weiter wie vor 40 Jahren geführt, so, wie wenn immer noch mit Schreibmaschinen geschrieben würde. Daran etwas zu ändern, ist schwierig, viele haben keine Zeit und Lust, in die Digitalisierung zu investieren. Kontakte sind zwar da, aber es ist schwierig, einen Gesprächstermin zu bekommen. Wo die Leute in Zukunft arbeiten sollen, ob zuhause oder im Büro, muss nicht reguliert werden. Das wird der Markt regeln. Der Tesla-Chef sieht das im Moment zwar anders.
Dominique Reber: Woher kommt die Zurückhaltung gegenüber der Digitalisierung? Spielt die Kultur mit?
Dirk Lindenmann: Wir stellen fest, dass die Haltung in der Westschweiz dogmatischer ist. Über eine Swiss cloud reden viele, die nicht viel Ahnung haben. Eine government cloud kann nicht unabhängig von den USA aufgebaut werden, auch wenn im Nationalrat ein entsprechender Vorstoss gemacht wurde. Für eine exklusive Swiss cloud sind unsere Ressourcen zu begrenzt. Es geht darum, den Datenaustausch mit der Cloud zu verschlüsseln.
Publikumsfrage: Für eine autonome europäische Cloud haben sich doch Firmen und Staaten zusammengeschlossen?
Dirk Lindenmann: Es sind zu viele Köche am Kochen. Wir werden uns den Datenräumen, die entstehen – zum Beispiel im Pharmabereich – anschliessen müssen.
Dominque Reber: Wie funktioniert die Zusammenarbeit mit der Digitalen Verwaltung Schweiz?
Dirk Lindenmann: Eine erste Sitzung hat stattgefunden, ich bin dabei, auch das Bundesamt für Justiz und das Bundesamt für Statistik. Wir sind dabei, Strategien auszuarbeiten: Was ist digitale Verwaltung Schweiz? Werden nur Projekte unterstützt? Oder Organisationen mit eigenen Projekten? Wenn wir es richtig anpacken, ist die Digitale Verwaltung Schweiz ein wichtiger Hebel. Wichtig ist, von guten Beispielen, z.B. Kanton Luzern, auszugehen und sie in der Schweiz weiterzuverbreiten. Es muss ein Ökosystem geschaffen werden, wo alle voneinander profitieren und nicht einzelne vor sich hinwerkeln.
Dominique Reber: Was bringt der Digital Day dieses Jahr?
Sascha Zahnd: Dieses Jahr liegt der Fokus auf den Regionen. Während 7 Wochen, vom 5. September bis zum 23. Oktober, organisiert digitalswitzerland eine Reihe von lokalen Digitaltagen in 7 Regionen. 30 Städte machen mit. Ein gutes Beispiel ist Biel. In Biel gibt es einen Chief Digital Officer, der in Schulen aktiv ist und z.B. auch Roboterkurse organisiert.
Victor Schmid: Es fällt auf, dass es bei der Digitalisierung an Selbstbewusstsein mangelt. Das Projekt Twint wurde am Anfang ausgelacht, es wurde gesagt, Twint habe gegen Apple Pay keine Chance.
Sascha Zahnd: Die besten Ingenieure bei Tesla waren Europäer, Deutsche und auch Schweizer. Wir dürfen selbstbewusst sein, wollen aber immer alles perfekt machen, Software aber ist nicht immer perfekt, da beruht vieles auf Trial und Error. Das Covid-Zertifikat ist aber ein gutes Beispiel dafür, dass in kurzer Zeit etwas geschaffen werden konnte, das akzeptiert ist. In der Bundesverwaltung gibt es Leute, die haben mehr Angst, sich zu exponieren als noch vor wenigen Jahren. Es ist aber kontraproduktiv, für alles sofort ein Reglement zu verlangen.
Dirk Lindenmann: Die guten Dinge werden zu selten benannt, eher die schlechten als Beispiel herangezogen. Das Covid-Zertifikat hat einen Preis als bestes europäisches Zertifikat gewonnen. Auch die Apps der Zollverwaltung gewinnen internationale Preise. In der Schweiz genügen acht Stunden für die Mehrwertsteuer-Eingabe, in Europa sind es 68 Stunden. Wir sind also gar nicht so schlecht. Im Digitalisierungsindex liegt die Schweiz nur knapp hinter Singapur zurück.
Markus Seiler, EDA-Generalsekretär: Wir sind zu sehr risikogesteuert. Bei der Debatte über die Mitgliedschaft der Schweiz im Uno-Sicherheitsrat wurde nur gefragt, welche Risiken die Schweiz damit eingehe. Es liegt in unserer DNA, dass wir uns zunächst immer einmal entschuldigen. Auch beim Thema Ukraine sind wir konditioniert, Risiken zu vermeiden. Es braucht aber den Mut, Fehler zu machen.
Publikumsfrage: Wo wollen wir in 5 – 10 Jahren stehen?
Dirk Lindenmann: Es gibt Statistiken, die uns weiter hinten, andere, die uns weiter vorne sehen, im Steuerwesen auf Platz 1. Punkto Dienstleistungen im Gemeindebereich schneiden andere Länder besser ab, die Kantone haben aber aufgeholt. In 5 Jahren möchten wir logischerweise auf Platz 1 sein. Ich bin im Maschinenraum und hoffe, dass wir nicht mit Kohle arbeiten.
Sascha Zahnd: Wir sollten so gut sein wie die baltischen Staaten, wie Israel, wie China, wie das Silicon Vall