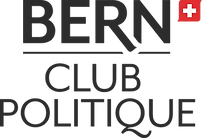Jubiläumsanlass Teil 2:
«Dialog von Politik und Wirtschaft in der Krise?»
Mittwoch, 3. Mai 2023, Hotel Schweizerhof, Bern
Moderation:
Dr. René Buholzer, Mitglied des Vorstands
Auf dem Podium:
Rebekka Wyler, Gemeinderätin in Erstfeld UR und Co-Generalsekretärin der SP Schweiz
Valentin Vogt, Präsident des Arbeitgeberverbandes
Prof. Adrian Vatter vom Büro Vatter in Bern
Präsentation der Studie:
Dr. Christian Bolliger (Studienleiter)
Die Studie:
Wirtschaft_Politik_2_Rekrutierungsproblem_20230302 (1)
STUDIE _ Wirtschaft_Politik_Politikfinanzierung
(Die Zusammenfassung erfolgt unter Chatham House Rules)
Professionalisierung hier, Personalmangel da: Der Rückzug des Milizsystems und seine Auswirkungen auf nationaler und kommunaler Ebene
Im Auftrag des Club Politique hat das Büro Vatter die Auswirkungen der neuen Transparenzvorschriften bei der Parteienfinanzierung untersucht. Im zweiten Teil der Studie lag der Fokus auf dem Milizsystem in den Gemeinden. Die Fragestellung lautete: Braucht das Milizsystem der Gemeinden Anreize oder einen Kulturwandel? Als Grundpfeiler unseres politischen Systems beinhaltet das Milizsystem, die gesellschaftlichen Gruppen direkt an dessen Gestaltung zu beteiligen. Die Kernfrage der Untersuchung lautete, ob und mit welchen Folgen die Professionalisierung das Bundesparlament von der Wirtschaft entfremde. Zudem wurde die Vereinbarkeit von Berufsarbeit und Milizamt und die Rolle der Wirtschaft als Trägerin des Milizsystems analysiert. Die Studie fragte, wie die Vereinbarkeit wieder gesteigert werden könnte, insbesondere auch auf kommunaler Ebene.
Bevor Studienleiter Christian Bolliger vom Büro Vatter an diesem Abend genauer auf die Ergebnisse des zweiten Teils eingeht, erlaubt er sich ein paar allgemeine Betrachtungen. Seit vierzig Jahren würden wir nunmehr immer wieder über die Krise des Milizsystems sprechen. Und dieser Krisenherd sei nie erloschen. «Wir wollten mit der Studie einen Tropfen Wasser in dieses Feuer giessen, damit es kleiner wird.» Er unterstreicht die Wichtigkeit des Milizsystem als einer von vier Säulen der Beteiligungsdemokratie, nebst dem Föderalismus, der direkten Demokratie und dem Konkordanzsystem, die zusammen den sogenannten Goldstandard der Beteiligung bilden. Doch diese vierte Säule bröckle, so Bolliger. Einerseits beim Bundesparlament, wo mehr und mehr Profis Einsitz nähmen. Und auf Gemeindeebene sei es ein Mangel an Personal, zurückzuführen auf die Schwierigkeiten der Vereinbarkeit von Miliz und Beruf.
Die Zahl der Milizämter ist vor allem aufgrund von Gemeindefusionen seit Ende der 1980er-Jahre um rund ein Drittel auf 100’000 zurückgegangen. Dennoch seien die Rekrutierungsprobleme gerade bei kleinen bis mittelgrossen Gemeinden beträchtlich. Die Hälfte der Gemeinden bezeichne es als sehr schwierig bis schwierig, genügend Kandidierende für die Exekutivämter aufzubringen. Die Ursachen des Rekrutierungsproblems unterteilt Bolliger in drei Sphären: Staat, Gesellschaft und Arbeit. Im staatlichen Bereich hätten die zeitliche und inhaltliche Belastung zugenommen, verschärft durch konstant steigende Komplexität. Auf die Gesellschaft bezogen hinderten die zunehmende Individualisierung und der Drang zur Selbstverwirklichung die Bereitschaft, sich auf ein solches Amt einzulassen. Und in der Öffentlichkeit sinke die Anerkennung für solche Ämter und Personen sowie gleichzeitig die Hemmschwelle für Drohungen und Diffamierungen. Punkto Arbeit würden die gestiegenen Anforderungen im Erwerbsalltag als zunehmend schwierig für eine Vereinbarkeit eines Exekutivamtes mit den Anforderungen des Berufes und der Familie wahrgenommen.
Das Rekrutierungsproblem sei auch ein klassisches Trittbrettfahrerproblem. Die Bereitschaft der Unternehmen, ihren Mitarbeitenden die Miliztätigkeit zu ermöglichen, sei unterschiedlich ausgeprägt. Gewiss engagierten sich stark, andere weniger, den Nutzen hätten hingegen alle. Arbeitgeber profitierten von den im Milizamt erworbenen Führungsqualitäten und Kompetenzen sowie der besseren Vernetzung und Verankerung des Unternehmens in seinem Umfeld. Allerdings sei auch der Nachteil der vermehrten Abwesenheit und der öffentlichen Exponiertheit von Miliztätigen nicht zu unterschätzen. Die Flexibilisierung der Arbeitszeit lasse das Feld von Milizkräften wachsen, allerdings seien die Beteiligungsmöglichkeiten sozial ungleich verteilt.
Eine solidarische Finanzierung der Miliztätigkeit stosse in der Wirtschaft auf geteiltes Echo. Am ehesten akzeptiert werde eine Lösung via Erwerbsersatzordnung EO. Vermutet werde allerdings, dass das Rekrutierungsproblem eigentlich nicht auf zu tiefer Entschädigung, sondern auf einer gesamtgesellschaftlich rückläufigen Bereitschaft basiere. Eine Stärkung der Gemeinwohlorientierung stehe für den Erhalt des Milizsystems im Mittelpunkt. Erstrebenswert sei deshalb die Fortführung und Intensivierung von Information und Sensibilisierung. Bei einer Rückbesinnung aufs Gemeinwohl stünden strukturelle Hürden im Weg. Jene Unternehmen, die sich engagierten, täten dies aus staatspolitischer Überzeugung. Aber nicht alle wollten ein Opfer bringen und Freiwilligkeit könne nicht per se verordnet werden.
«Wie erleben Sie persönlich diese Situation?», formuliert Moderator René Buholzer dann die Einstiegsfrage ans Podium. Für Rebekka Wyler ist aus ihrer Erstfeld-Optik ganz klar: «Für Berufstätige ist vor einer allfälligen Realisierung entscheidend: Finden die Ämter tagsüber statt? Die Kontakte und das Wissen, das man dazugewinnen kann, sind jedoch unbezahlbar», wirbt sie für ein solches Engagement, «Politik ist tägliche Weiterbildung.« Für Valentin Vogt hat sich die Frage nach einer aktiven Polittätigkeit gar nie gestellt. «Ich war mit meiner unternehmerischen Tätigkeit und nun mit dem Verband immer voll ausgelastet, dazu kamen 1400 Diensttage bei der Armee. Und ich bin besser im Führen, als im Geführtwerden. Ich habe Freude, mit anderen Leuten Dinge zu bewegen, das gibt mir eine innere Befriedigung.» Als besorgniserregend möchte Adrian Vatter die aktuelle Situation nicht bezeichnen. «Doch der Trend zur Abnahme hat sich schon markant verstärkt. Wichtige Faktoren dafür sind Globalisierung und Individualisierung. Die Entwicklung der Gesellschaft trägt massgeblich dazu bei, dass immer mehr Leute nicht mehr für solche Ämter zu gewinnen sind.»
Dann folgt der Spruch des Abends, Urheber ist Valentin Vogt. Der Mangel an möglichen Interessenten für solche Ämter sei ein Dauerthema und man könne gar nie genug tun, die Allgemeinheit noch mehr dafür zu sensibilisieren. Aber es seien halt auch nicht ganz alle für solche Chargen geeignet. «Am schlimmsten sind jene Leute, die Zeit haben», sagt er und erntet Lacher von allen Seiten, mit ihnen gestalte sich die Zusammenarbeit immer besonders schwierig. Vatter hält leicht augenzwinkernd dagegen. «Es wäre nicht gut, grundsätzlich Leute auszuschliessen, die Zeit haben». Den eigentlichen Ansatzpunkt sehe er hier im Saal: «Ich zähle sehr viele Männer über 50. Frauen wären aber auch anzusprechen und jüngere Menschen.» Wyler taxiert Vogts Aussage als «sehr ehrlich. Vogt hat Recht, Vatter aber auch. Wir brauchen mehr Breite. Doch ich weiss, was Vogt meint. Wir haben in der SP ebenfalls Leute, die sich stark aufdrängen und sich später als sehr betreuungsintensiv entpuppen.»
Vatter kommt noch einmal auf die Individualisierung zurück. «Wir beobachten generell eine vermehrte Kurzfristigkeit und Unverbindlichkeit. Man will sich einfach nicht mehr längerfristig engagieren. Dafür springt man auf rasch prosperierende Bewegungen an, Stichwort Klimabewegung. Das wird auch in der Politik die Zukunft sein. Es wird schwieriger werden, Leute für Arbeiten zu gewinnen, die von aussen gesehen eher langweilig wirken.» Vatter empfiehlt, das «brachliegende Potential besser auszuschöpfen und auch juristische Personen einzubinden. Man könnte solche Tätigkeiten auch als Dienstpflicht interpretieren und anstelle des Zivildienstes eine Art Gemeinde-Engagement forcieren. Gerade für junge Leute könnte dies ein attraktives Modell sein.»
Vogt seinerseits mahnt, die bereits Aktiven nicht zu vergessen und ihre Tätigkeit nicht als selbstverständlich hinzunehmen. «Wertschätzung ist am Wichtigsten. Ich habe in den von mir geführten Betrieben einmal im Jahr all jene versammelt, die sich politisch engagieren, und habe ihnen aufrichtig gedankt. Solche Leute haben unabhängig von ihrer Parteizugehörigkeit eine Vorbildfunktion.» Wyler ortet die grössten Schwierigkeiten bei den Rahmenbedingungen. «Die Mehrfachbelastung ist ein Problem. Gerade bei Frauen, die gleichzeitig Mütter sind. Die derzeitige Situation, dass Mütter ihre Entschädigung verlieren, wenn sie an Ratssitzungen teilnehmen, ist ein Skandal, sollte ja aber in Bälde vom Parlament korrigiert werden.» Potential sieht auch sie bei Frauen, Jungen und niedergelassenen Ausländern. Eine Senkung des Stimmrechtsalters auf 16 hingegen würde ihrer Meinung nach die Situation nicht entschärfen. «Solche Leute wären für ein Exekutivamt zu jung.» Beim Aspekt der niedergelassenen Ausländer merkt Vatter an: «Für ein Exekutivamt braucht es umfangreiche Lokalkenntnis, nötig ist eine intensive Auseinandersetzung mit unserer politischen Kultur.»
Droht mit der Zunahme von Berufspolitikern auch eine Entfremdung von der Bevölkerung? «Bei Leuten, die nie in einem Beruf gearbeitet haben, stellt sich schon die Frage, wo ihre Praxisnähe herkommt», hält Vatter fest. Dazu komme das mögliche Problem der Amtszeitbeschränkung. «Was machen sie nach 40, wenn sie plötzlich wieder austreten müssen?» Für Wyler ist dies gar ein eigentliches Paradoxon. «Faktisch sind die meisten ‚Milizler‘ mit der nötigen Erfahrung Männer über 50, die sich an ihre Ämter klammern. Mit der angestrebten Diversität wird es da schwierig.» Vogt erinnert zudem an die Wichtigkeit, potentiellen Einsteigern die nötige Basis in Erinnerung zu rufen. «Wirtschaft ist nicht alles. Aber ohne Wirtschaft ist alles nichts. Vielfach entsteht das Gefühl, dass alles vom Himmel fällt. Doch es braucht vor allem Arbeit, harte Arbeit.»
Ein willkommener Steilpass für Wyler: «Wie können wir ermöglichen, dass wieder ein Heizungsmonteur Bundesrat wird wie Willi Ritschard?», fragt sie. Vatter relativiert: «Das Parlament war nie ein Spiegelbild der Gesellschaft, sondern immer Anziehungspunkt für eine gewisse Elite. Wichtig ist, welche Werte und Interessen die Parlamentarier vertreten.» Die Crux sieht er bei den unterschiedlichen Vorstellungen von Politik. «Demokratie fordert Transparenz ein, was aber nicht alle wollen. Manche Kreise scheuen sich vor einer Offenlegung ihrer Interessen.» Wylers Bilanz: «Je vielfältiger Gremien zusammengesetzt sind, umso besser widerspiegeln sie die Interessen der ganzen Gesellschaft. Es braucht alle vier Säulen, um unsere Demokratie zu tragen. Und alle müssen einen Beitrag dafür leisten.»
Die Fragen aus dem Saal betreffen erstens die zunehmende Professionalisierung. Adrian Vatter sieht hier ein Defizit im Vergleich zu ausländischen Modellen. «Leute in politischen Ämtern verdienen heute mehr als früher. Doch die Infrastruktur ist immer noch nicht ausreichend. Amtsträger können oftmals niemanden für zeitraubende administrative und verwaltungstechnische Aufgaben engagieren.» Und er ist überzeugt: «Wenn wir an den Schulen mehr politische Bildung hätten, hätten wir das Fundament, dass sich auch mehr Leute für solche Ämter interessieren würden.» Rebekka Wyler meint ironisch: «Für manche Leute ist ja schon das Verstehen des Abstimmungsbüchlein schwierig.» Unterstrichen werden in einem Saalvotum auch die Gefahren der Professionalisierung: «Wenn wir das weiter so forcieren, diskutieren am Schluss die Sachbearbeiter der Politiker untereinander, wie wir das im deutschen Parlament beobachten können», so die Befürchtung. Und weiter: «Auf Gemeindeebene ist es heute so, dass man keine Chance mehr hat, wenn man nicht aus der Verwaltung kommt. Was absolut keinen Sinn macht. Miliz sollte eben auch heissen: Nicht alle sind Profis.»
Weiter wird im Saal auch die Aussenwahrnehmung kritisch betrachtet. «Das Vier-Säulen-Prinzip funktioniert besser, als uns die Journalisten weismachen wollen», so die entsprechende Feststellung. Doch der Votant unterstreicht die Wichtigkeit eines echten Praxisbezuges. «Es müsste zwingend vorgeschrieben sein, dass ein 27-Jähriger nach seinem Studium nicht gleich eine hoch dotierte Stelle beim Kanton antreten kann, sondern zuerst noch eine Reihe von Praktikas durchläuft. Wir sind sehr professionell geworden, aber leider auch sehr theoretisch», so die pointierte Feststellung, ergänzt durch ein Zitat des französischen Philosophen Claude Lévi-Strauss: Niemand weiss, wohin er geht, wenn er nicht weiss, woher er kommt. Plädiert wird deshalb für eine starke politische Bildung schon in jüngeren Jahren. «Doch viele Lehrer haben keine Ahnung von Schweizer Geschichte mehr. Hier müssten wir ansetzen.»